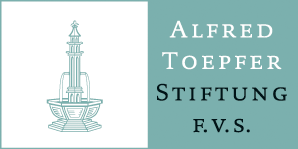 An einem schönen Maitag treffe ich Ansgar Wimmer, seit 2005 Vorstandsvorsitzender der Alfred-Toepfer-Stiftung F.V.S. in Hamburg. Die gemeinnützige Toepfer-Stiftung engagiert sich europaweit auf den Gebieten Kultur, Wissenschaft, Bildung und Naturschutz. Unter dem Namen Stiftung F.V.S. wurde sie 1931 von dem Hamburger Kaufmann Alfred Toepfer gegründet. Auf Grund seiner Unterstützung für einzelne Ziele, Personen und Organisationen des nationalsozialistischen Regimes setzt sich die Toepfer-Stiftung seit Jahren öffentlich mit ihrer eigenen Geschichte auseinander.
An einem schönen Maitag treffe ich Ansgar Wimmer, seit 2005 Vorstandsvorsitzender der Alfred-Toepfer-Stiftung F.V.S. in Hamburg. Die gemeinnützige Toepfer-Stiftung engagiert sich europaweit auf den Gebieten Kultur, Wissenschaft, Bildung und Naturschutz. Unter dem Namen Stiftung F.V.S. wurde sie 1931 von dem Hamburger Kaufmann Alfred Toepfer gegründet. Auf Grund seiner Unterstützung für einzelne Ziele, Personen und Organisationen des nationalsozialistischen Regimes setzt sich die Toepfer-Stiftung seit Jahren öffentlich mit ihrer eigenen Geschichte auseinander.
Heute stehen jedoch nicht die Toepfersche Historie im Mittelpunkt des Gesprächs, sondern die Bedeutung von Netzwerken und die Arbeitschancen von GeisteswissenschaftlerInnen, unter anderem auch im Stiftungssektor.
Schwerbrock: Herr Wimmer, vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gespräch Zeit genommen haben! Was fällt Ihnen zum Thema „Netzwerk“ ein? Wie wichtig ist das Netzwerken aus Ihrer Sicht, auch in Bezug auf Ihre Stiftungsarbeit? Was braucht ein gutes Netzwerk?
Wimmer: Dazu gibt es eine zweiteilige Antwort: Zum einen führt unsere Stiftung heute nur noch Programme und Projekte in Kooperation durch. Dazu braucht es natürlich Netzwerke – um in diese Kooperationen zu kommen, muss man Partner finden. Aber was vielleicht noch viel wichtiger ist, ist, dass in Netzwerken Ideen entstehen. Auf unserer Imagebroschüre ist vorne ein Netz zu sehen und darüber steht „Wie Ideen entstehen“. Erwachsene lernen durch Kommunikation, in dem sie sich mit anderen austauschen und nicht dadurch, dass sie in der stillen Stube brainstormen. Deshalb sind für uns – die Toepfer Stiftung – Netzwerke eine Quelle der Inspiration und des Neuen, was im Netz entsteht. Ein gutes Netzwerk braucht Augenhöhe und immer auch mal unwahrscheinliche Partner – denn wenn sich immer nur die gleichen Leute vernetzen, kommt nichts Neues in die Welt. Außerdem braucht ein gutes Netzwerk zwischendurch auch mal Ruhe: Es gibt so Tage, an denen man nur in einem und dem nächsten Vernetzungstreffen sitzt – das braucht man eben auch nicht.
Schwerbrock: Nach der Weiterbildung zu Fachreferenten für Kulturtourismus und –marketing hat unser REGIALOG-Jahrgang das Netzwerk „KulturN“ gegründet: Welche Veranstaltungen, Xing-Gruppen etc. gibt es im Stiftungsbereich, um sich kennen zu lernen, sich auszutauschen und in Kontakt zu bleiben?
Wimmer: Mit einem ähnlichen Ziel hat sich vor ein paar Jahren ein Arbeitskreis junger Menschen im Stiftungswesen gegründet (Kreis Junge Menschen und Stiftungen, Anm. d. Red.).
Das sind Berufseinsteiger, die sich untereinander vernetzen, Hinweise geben, sich beraten. Ursprünglich wurde dieses Vorhaben von der Stiftung Elemente der Begeisterung aus Leipzig initiiert. Sinnvoll ist es auch, sich für den Deutschen Stiftungstag und den Bundesverband Deutscher Stiftungen zu interessieren, die regelmäßig Berufseinsteiger-Volontariate im Stiftungssektor anbieten. Außerdem gibt es auf lokaler Ebene in vielen größeren Städten Arbeitskreise der dort tätigen Stiftungen, die Stiftungstage und sonstige Aktivitäten zum Stiftungswesen organisieren. Das sind alles gute Adressen und Anlaufpunkte.
Schwerbrock: Wie beurteilen Sie die Arbeitschancen von Geisteswissenschaftlern bei Stiftungen? Wie qualifiziere ich mich am besten, welche Voraussetzungen muss ich mitbringen?
Wimmer: Es gibt einige wenige formale Qualifikationen, die man in Deutschland erwerben kann: Ob das der zertifizierte Stiftungsmanager bei der Deutschen StiftungsAkademie ist oder der Masterstudiengang an der Universität Heidelberg, der auf eine Arbeit im Stiftungswesen vorbereitet. Jenseits dieser formalen Qualifikationen ist es jedoch wichtig, schon früh in der Ausbildung den Kontakt zu Stiftungen zu suchen oder ein Berufseinsteigerpraktikum zu machen, damit man von innen heraus weiß, wie Stiftungen ticken und man erste Visitenkarten abgeben kann.
Worauf achten Kollegen, wenn sie im Stiftungssektor einstellen? Im wachsenden Maße auch darauf, dass man mal Erfahrungen auf der anderen Seite hatte, dass man weiß, wie es ist, Partner oder Zuwendungsnehmer von einer Stiftung zu sein. Es hat mal eine ganze Generation von Leuten gegeben, die ihren Berufseinstieg sofort bei einer Stiftung gemacht haben und die dann die Nase relativ hoch getragen haben, ohne dass es dazu einen Grund gegeben hätte.
Zum einen sind also die formalen Qualifikationen wichtig, vor allem aber das „Hineinwühlen“ in den Sektor, in dem man partnerschaftlich Projekte mit Stiftungen oder Praktika macht und sich auch dafür interessiert, welche neuen Stiftungen entstehen.
Schwerbrock: Welche Zugangsmöglichkeiten in die Stiftungsarbeit gibt es für Geisteswissenschaftler? Wie viele von ihren Mitarbeitern haben einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund?
Wimmer: Die Fluktuation im Stiftungssektor ist nicht so hoch, da die Leute, die dort arbeiten, meist sehr viel Spaß an der Arbeit haben – wenn sie dann nicht gerade in Elternzeit gehen oder einen ganz anderen Werdegang z.B. in politischer Richtung einschlagen. Die Stellenbörsen zeigen nur – als Schätzung – ein Drittel der tatsächlich zu besetzenden Stellen im Stiftungssektor. Wichtig ist, dass man einen breiten Blick wagt und eben nicht nur bei der Körber-Stiftung, der Bertelsmann Stiftung und der Robert Bosch Stiftung guckt, sondern im ganzen Land. Die Bundesrepublik Deutschland hat heute über 150 Bürgerstiftungen, die zwar alle nicht viele Mitarbeiter haben, aber eben doch ein paar. Und wenn man sich dann nicht zu schade ist, nicht nur auf dem Prenzlauer Berg sondern eben in Iserlohn (hier sitzt z.B. die Dr. Kirchhoff Stiftung, Anm. d. Red.) oder Kamen (hier wiederum die Auerbach Stiftung, Anm. d. Red.) oder in Radolfzell (Werner und Erika Messmer-Stiftung, Anm. d. Red.) Stiftungsarbeit zu machen … Das hat im Übrigen auch den Charme, dass sehr vermögende Stifter mitnichten ihre Stiftungen in den großen Metropolen errichten, sondern eher außerhalb: Die Bertelsmann Stiftung sitzt in Gütersloh und ebenso haben sich viele andere Stiftungen in ähnlich populären Mittelzentren etabliert. Um zu Ihrer anderen Frage zu kommen: In der Toepfer-Stiftung arbeiten zwei Kulturwissenschaftlerinnen, eine Politikwissenschaftlerin, eine Ethnologin, eine Literaturwissenschaftlerin und eine Germanistin – also fast ausschließlich Geisteswissenschaftlerinnen!
Schwerbrock: Nun würde ich gerne mehr über die Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. erfahren: Können Sie die Zielsetzung und entsprechenden Aufgabenfelder der Toepfer-Stiftung kurz vorstellen?
Wimmer: Die Zielsetzung ergibt sich aus den drei programmatischen Aufgabenbereichen der Toepfer-Stiftung, die wir in der letzten Zeit neu geordnet haben. Unser Kernanliegen und somit der erste Programmbereich ist, Biografien zu begleiten, früher haben wir gesagt „In Menschen investieren“, d.h. klugen, engagierten Menschen in ihrem Werdegang eine gewisse Weile beizustehen, sie zu ermutigen. Das kann über ein Stipendium, eine Preisauszeichnung oder ein gemeinsames Projekt sein. Im Vergleich zu vielen anderen sind wir eine kleine Stiftung – unser Hebel ist nicht eine große institutionelle Förderung, sondern durch die Biografien von Menschen zu wirken. Den zweiten Programmbereich beschreiben wir mit „Veränderungen wagen“. Das sind die Felder, in denen wir nicht durch die Biografie, sondern strukturell versuchen, Veränderungen zu erzeugen. Hier sind wir im Bereich guter wissenschaftlicher Lehre unterwegs, neuer Konzertkultur, der Frage, wie viel Vielfalt findet in Museen statt und auch unsere Bildungsprojekte sind hier untergebracht. Als drittes ist der Programmbereich „Raum geben“ zu nennen. Die Toepfer-Stiftung hat aus ihrer spezifischen und nicht ganz einfachen Historie mehrere Gästehäuser, die wir als Instrument der Förderung nutzen. Wir öffnen sie für wissenschaftliche Tagungen, gesellschaftspolitische Themen, Fachveranstaltungen oder Klausurtagungen. Außerdem haben wir ein kleines Museum für Oral History, das Museum für Hamburgische Geschichtchen– das alles fällt unter die Kategorie Raum geben.
Schwerbrock: Gemeinsam mit der Körber-Stiftung, der Kulturstiftung der Länder sowie durch die fachliche Unterstützung des Deutschen Museumsbundes haben Sie das Projekt „Museion21“ auf die Beine gestellt: Was beinhaltet das Projekt, was sind die Ziele?
Wimmer: Wir haben im letzten Jahr zwei Projekte im Museumsbereich angestoßen: Museion21 ist unlängst mit einer bundesweiten Ausschreibung in der Zeitung auf den Weg gebracht worden. Mehrfach wurde an uns herangetragen, dass es schwierig ist, Führungsnachwuchs für Museen zu finden: Die Menschen, die in Museen arbeiten, qualifizieren sich häufig durch eine bestimmte Fachlichkeit. Da ist dann der Kurator für südostasiatisches Porzellan, der auf jeder Fachtagung mit seinem Fachwissen brilliert. Wenn der eigentlich so weit wäre zu sagen, jetzt will ich auf die nächste Ebene, Verantwortung übernehmen, dann fehlen ihm ganz viele Komponenten: nämlich im Bereich der Personalführung, Rechnungslegung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, all das also, was man in Führungspositionen braucht. Hier wollen wir ansetzen und über drei Jahre in drei Jahrgängen insgesamt 60 Menschen qualifizieren, an großen deutschen Museen Führungsverantwortung zu übernehmen.
Der Deutsche Museumsbund hat uns gute fachliche Hinweise gegeben, da es natürlich als Stiftung nicht ganz einfach ist, die Bedarfslage einzuschätzen. Er hat seine Unterstützung bei der Ausschreibung zugesagt und er wird uns auch helfen, Referenten für diese Fortbildung zu finden. Die Fortbildung ist aus vier Modulen aufgebaut: Wir wollen zunächst den Menschen Gelegenheit geben, über ihre Selbstwirksamkeit nachzudenken, also was für eine Führungspersönlichkeit bin ich eigentlich?
Im zweiten Schritt geht es darum zu überlegen, was man die ersten 100 Tage als LeiterIn eines großen Museums macht, was sind die ersten wichtigen Schritte? Das dritte Modul wird sich mit dem Regelbetrieb befassen, also was mache ich, wenn es langweilig wird? Wie kann ich mein Haus im Regelbetrieb attraktiv und lebendig halten? Das vierte Modul befasst sich dann mit der Krise: Was ist, wenn z.B. bei mir der von den Nazis geklaute Goldschatz entdeckt wird, der das Herzstück meiner Ausstellung ist und wie gehe ich dann damit um?
Schwerbrock: Mit dem Museumsstipendium „Kulturelle Vielfalt & Migration“ fördert die Toepfer-Stiftung gut ausgebildete Akademiker mit Migrationshintergrund in Museen in Norddeutschland: Wie kam es zu der Kooperation mit dem Übersee-Museum in Bremen (als einziges Museum außerhalb Hamburgs)?
Wimmer: Zunächst einmal ist es wichtig zu erzählen, wie es überhaupt zu dem Programm kam, das wir der damaligen Leiterin des Museums der Arbeit zu verdanken haben. Sie trat an uns heran und meinte: Das, was wir wirklich einmal gebrauchen könnten sind Menschen, die was von Migration verstehen, vielleicht selber einen Migrationshintergrund haben. Die tauchen in Museen sonst nur als Aufsichtswärter und Putzfrauen auf – um es mal polemisch zu sagen. Anders als im Kunstbereich, der ein eher internationales Konstrukt ist, ist in kulturhistorischen Museen das Thema Migration meist nur ausstellungsrelevant. Daraufhin sind wir in eine Allianz mit anderen Stiftungen gegangen: Krupp-Stiftung, Bosch Stiftung, Stiftung Polytechnische Gesellschaft und haben uns ein bisschen umgetan. So hat das Museum der Arbeit und das Hamburg Museum eine solche Stelle bekommen. Ebenso wollten wir deutlich machen, dass wir anderswo in Norddeutschland auch förderbereit sind und sind dadurch auf das sehr dynamische Übersee-Museum in Bremen gestoßen.
Schwerbrock: Für die Millerntorwache, die im 17. Jahrhundert als Haupttor an der Westseite der Stadt diente, hat sich die Toepfer-Stiftung ein sehr schönes Nutzungskonzept überlegt: Das MUSEUM FÜR HAMBURGISCHE GESCHICHTCHEN ist ein Ort zum Erzählen und Zuhören… Wie kann ich mir diesen Ort vorstellen, wie gestaltet sich der Alltag dort?
Wimmer: Die Millerntorwache steht an der früheren Grenze zwischen Hamburg und Altona und ist eine alte klassizistische Stadtwache, die als solche auch wirklich gedient hat. Auf Grund der Verkehrsbedingung ist sie vor ein paar Jahren durch das Engagement der hiesigen Lions um 30 Meter versetzt und hergerichtet worden und im Zuge dessen ist die Frage aufgekommen, was man mit der Wache eigentlich machen kann. Für ein Museum ist sie eigentlich zu klein und für das, was es vorher mal war, nämlich eine „Tattoobude“ und eine Theaterkasse, war sie den Beteiligten zu schade. Im Frühjahr letzten Jahres hat das Hamburg Museum einen Ideenwettbewerb ausgeschrieben. Als Toepfer-Stiftung haben wir eine Weile überlegt, ob wir uns daran beteiligen. Inspiriert durch den früheren Namen „Museum für Hamburgische Geschichte“ haben wir gedacht, das sieht doch aus wie ein kleiner Bruder und sind eben auf die Idee der „Geschichtchen“ gekommen. Es ist also ein Museum für Oral History in einem Raum, 25qm groß, mit Aufzeichnungsmöglichkeiten, Video und Ton, einem gemütlichen Sofa, einer Kaffeemaschine und einem mittlerweile sehr lebendigen Team von 15 Ehrenamtlichen, die dort trainiert worden sind, Interviews zu führen und zuzuhören. Die Leute, die dort über ihre Hamburger Geschichtchen berichten, entscheiden selber, ob das was sie berichten für die große weite Welt, sprich das Internet oder für Forschungszwecke geöffnet wird oder ob sie es einfach nur mit nach Hause nehmen wollen. Für interessierte Erzähler gibt es eine Hotline, durch die man ein Vorgespräch vereinbaren kann, bei dem erst einmal besprochen wird, ob es um eine Historie seit 1900 geht oder nur um eine kleine Episode. Ohne Zuschauer oder Zuhörer findet dann die sehr private Erzählsituation zwischen dem Erzähler und einem der ausgebildeten Ehrenamtlichen statt, der Fragen stellt und das Gespräch aufzeichnet.
Schwerbrock: Nun eine letzte, eher persönliche Frage: Was raten Sie all den frustrierten Geisteswissenschaftlern, die zwischen Hartz IV und Honorarjobs auf Zeit den Einstieg in die „Kulturbranche“ versuchen?
Wimmer: Die Kulturbranche ist wirklich eine schwierige Branche, weil sie nur einem Bruchteil derer, die dort gerne wären, einen adäquaten und menschenwürdigen Broterwerb sichert. Der ganz große Teil derer, die dort unterwegs sind, machen das unter Selbstausbeutung, was ich auf Grund der Fragestellung gar nicht so betonen muss. Aber mit diesem Realismus muss man glaube ich erst einmal anfangen. Da sind Karrieren nur sehr bedingt planbar. Wenn ich was Konstruktives raten soll, dann gehe ich auf das zurück, was ich vorhin schon über den Stiftungssektor gesagt habe: Wer nach Berlin geht und meint, dann da im Kulturbereich mit einer Qualifikation, die hundert andere auch haben, ein Auskommen zu finden, der macht schon den ersten Fehler – so schön Berlin ist! Der Weg in die Provinz, in kleinere Kontexte, ist eher ein Weg der einen auffängt und Chancen bietet. In den kommunalen Kulturämtern gibt es auch noch Stellen. Es gibt auch Leute, die über Projektstellen dort hineinkommen, sei es z.B. über Ganztagsschulprogramme. Das ist dann eben nicht das „Deutsches Schauspielhaus Regie erste Reihe Mitte“ – das muss man realistisch sagen – aber das machen auch nur ganz wenige. Interessanterweise haben die, die dort ankommen, häufig auch den Weg über die Provinz gemacht. Die sind nicht in Hamburg gestartet, um dann in Berlin weiter zu machen. Das ist der eine, vielleicht nicht ganz originelle Rat. Zum anderen kenne ich viele Biografien von Leuten die sagen: Ja, ich mache Kultur, aber ich habe zusätzlich ein ganz rationales Standbein. Ich bin irgendwo in der Veranstaltungsorganisation bei einem Unternehmen oder ich machen PR bei irgendwas, wofür ich mich nicht schämen muss und hab dadurch aber so ein Grundauskommen, dass ich das, wo mein Herz dran hängt tun kann. Das ist vielleicht manchmal ehrlicher, als wenn man sagt, ich bin jetzt mit Leib und Seele Tanzpädagoge und ich möchte Kindern beibringen, ihren Namen zu tanzen und ich stelle aber nach 15 Jahren fest, das mir dafür aber keiner was zahlt. Ich glaube es ist wichtig, sich relativ illusionsfrei diesen Dingen zu stellen. Ein Feld, was auf absehbare Zeit immer wieder Menschen braucht, auch wenn es dann von Projektvertrag zu Projektvertrag geht, ist das Thema Kulturelle Bildung. Solange es Kinder gibt, wird das ein Thema sein. Aber auch da muss man sich ehrlich fragen, wenn man nur von Tanzen begeistert ist und Kinder hasst, ist man da natürlich auch verkehrt. Es gibt leider viel zu viele Menschen, die von Kultur begeistert sind, aber von Pädagogik zu wenig wissen!
Schwerbrock: Herr Wimmer, vielen Dank für das Gespräch!
Weitere Informationen über die Arbeit der Toepfer-Stiftung, Fördermöglichkeiten und einzelne Publikationen zur Geschichte der Stiftung finden Sie unter www.toepfer-fvs.de!
„Ich bin irgendwo in der Veranstaltungsorganisation bei einem Unternehmen oder ich machen PR bei irgendwas, wofür ich mich nicht schämen muss und hab dadurch aber so ein Grundauskommen, dass ich das, wo mein Herz dran hängt tun kann.“ (Zitat Wimmer) Ganz dolle Aussage! Das klingt nach: „Mach was anderes,damit du dich weiter ehrenamtlich engagieren kannst.“ Irgendwie wird man durch solche Bemerkungen immer tiefer in den Sumpf der Frustration geschupst.
Auch wenn ich davon immer ein Gegner war, aber es sollte ein nummerus clausus (nach Fähigkeiten) bei den geisteswissenschaftlichen Fächern in den Hochschulen eingeführt werden, damit sich der Markt beruhigt. Es nützt nichts, massenhaft auszubilden, um die Leute dann nackt auf der Straße stehen zu lassen. Von Luft und Liebe kann bekanntlich keiner hier leben.
Politisch und gesellschaftlich muss begriffen werden, dass das soziale und kulturelle Erbe nicht kostenlos ist.
Naja, der NC löst das angerissene Problem nicht. Wenn sich wieder nur die (geistes)wissenschaftlich bilden können, die gute Schulnoten haben, tritt ein Faktor wieder vermehrt in den Vordergrund: Bildung ist stark abhängig vom Geldbeutel. Es bestünde also die Gefahr, dass wir uns eine neue, betuchte Bildungselite heranzüchten.
Das ist die große Gefahr! Deshalb bin ich der Meinung, einen NC nach Neigungen und Fähigkeiten einzuführen, wie z.B. bei der Kunst. Natürlich kontrolliert da niemand die Einstellungskriterien und einige wirkliche Talente bleiben auf der Strecke, aber immernoch besser, als eine Überflutung des Marktes und Frustration unter den Jobsuchenden.